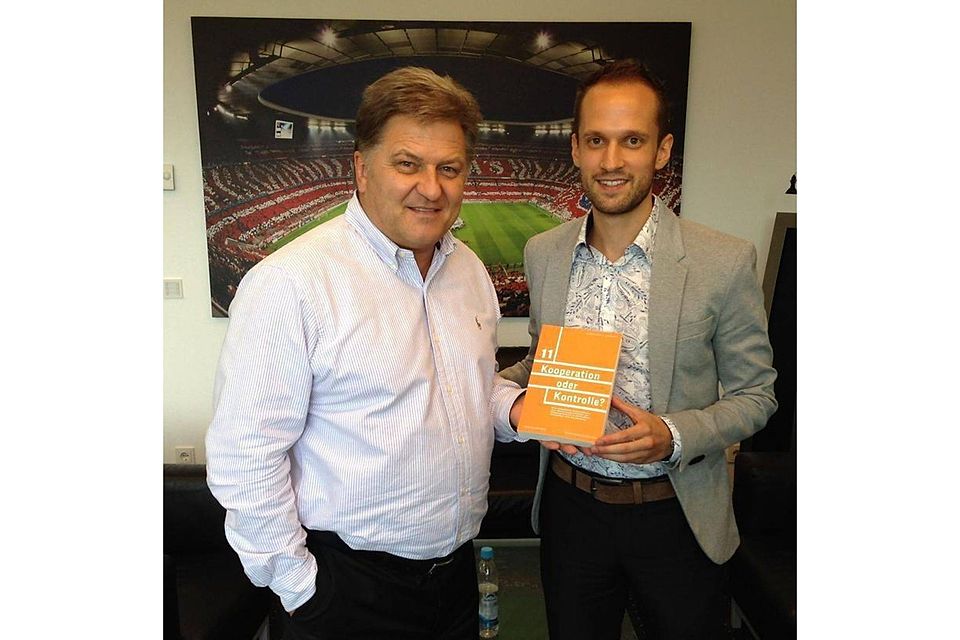
"Beide sind aufeinander angewiesen"
Untersuchung des Spannungsfeld von Pressesprechern und Journalisten
"Kooperation oder Kontrolle" heißt das Werk, in dem sich Grimmer auf mehr als 400 Seiten sehr intensiv und akribisch mit der Thematik auseinandersetzt. Das HT hat mit dem Autor gesprochen.
Das Spannungsverhältnis von Bundesliga-Pressesprechern und Journalisten beleuchten - wie sind Sie auf diese Thematik gekommen?
DR. CHRISTOPH G. GRIMMER: Parallel zu meiner Studienzeit habe ich Praktika in diversen Sportredaktionen absolviert und als freier Mitarbeiter für die Nachrichtenagentur dpa geschrieben. Dabei wurde mir bewusst, wie unterschiedlich Pressesprecher ihre Rolle interpretieren. Für Medienvertreter ist der Zugang etwa im Profihandball einfacher als im Fußball. Mein Eindruck war, dass es nicht nur am einzelnen Menschen liegt, sondern auch systemisch begründet sein könnte. Dieses Beziehungsgeflecht zwischen Journalisten und Klubsprechern wollte ich untersuchen.
Wie schwer war es, sämtliche Pressesprecher aus der Bundesliga zum Mitmachen zu motivieren?
DR. GRIMMER: In einer derart gefragten Branche wie der Fußball-Bundesliga rennt man keine offenen Türen ein. Sieben der 18 angefragten Sprecher reagierten positiv auf meine erste ausführliche Anfrage per Mail. Bei den anderen musste ich nachfassen und bin diplomatisch vorgegangen. Aus der langjährigen Beobachtung der Bundesliga war ich informiert, welche Sprecher als eher schwierig gelten. Sie konnte ich teilweise damit überzeugen, dass sich die Kollegen anderer Vereine schon beteiligt hatten. Nachgefragt habe ich grundsätzlich nur nach gewonnenen Spielen, wenn die Stimmung im Klub besser war. Der letzte interviewte Kommunikationsleiter sagte, es spreche für meine Hartnäckigkeit, dass ich alle 18 Pressesprecher getroffen habe. Das war das schönste Kompliment.
Wie lauten, kurz gefasst, die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung?
DR. GRIMMER: Das Verhältnis von Pressesprechern und Journalisten in der Fußball-Bundesliga ist von Ambivalenz und Komplementarität bestimmt. Beide Seiten sind einerseits aufeinander angewiesen, andererseits herrschen auf beiden Seiten Vorbehalte und teilweise Verärgerung über die Arbeit des anderen - Journalisten stellen nervige Fragen und sind selbst empfindlich. Pressesprecher sind Verhinderer und verbauen den Zugang zu Trainern und Spielern. Das ist sehr plakativ, aber ein Teil der Wahrheit. Überrascht hat mich, dass Journalisten die Sprecher dennoch besser bewerten, als die das selbst für möglich halten. Und Komplementarität bedeutet, dass sich beide Seiten in ihrer Arbeit auch ergänzen. Sprich: Jeder braucht den anderen, um selbst erfolgreich arbeiten zu können. Allerdings ist die Macht der Fußballvereine inzwischen so groß, dass beide Parteien die Abhängigkeit der Journalisten als größer einschätzen als die Abhängigkeit der Sprecher.
Inwieweit sind die Ergebnisse auch auf den lokalen Bereich vor Ort übertragbar?
DR. GRIMMER. Wissenschaftlich gesehen haben die Ergebnisse nur Gültigkeit für die Fußball-Bundesliga. Trotzdem denke ich, dass sich eine vergleichbare Gemengelage auch im Lokaljournalismus findet: Ein gutes Verhältnis zum Bürgermeister oder Gemeinderat erleichtert dem Journalisten die Informationsbeschaffung. Auf der Gegenseite erhöht eine "gute Presse" die Chance zur Wiederwahl. In der Lokalsportberichterstattung ist diese Abhängigkeit weniger gegeben. Mediale Wertschätzung wird von Vereinen und Sportlern als Würdigung erfahren. Erfolgreiche Lokalsportler haben womöglich auch bessere Chancen auf ein Sponsoring, wenn sie öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Deshalb liefern sie häufig noch Informationen zu, um auf sich hinzuweisen. Sollte zum Beispiel ein Fußball-, Handball- oder Basketball-Bundesligist im Verbreitungsgebiet angesiedelt sein, haben lokale Medien in der Regel über Jahre einen sehr engen Kontakt zum Klub, der diese Treue dann in der täglichen Zusammenarbeit honoriert.
Welche in die Zukunft reichenden Fragestellungen ergeben sich aus den Ergebnissen?
DR. GRIMMER: Eine nicht neue, aber umso aktuellere Frage ist die nach journalistischer Qualität. Das digitale Zeitalter ermöglicht Organisationen und Einzelpersonen, selbst kommunikativ tätig zu werden und eine eigene Öffentlichkeit herzustellen. Journalisten fallen hiermit als sogenannte Zwischenzielgruppe weg. Wozu braucht es dann noch Journalismus? Die Antwort: mehr denn je, weil unsere Welt zunehmend unübersichtlicher wird. Das Internet und Soziale Medien sind voll von Informationsmüll. Damit die wichtigsten und nicht die lächerlichsten Neuigkeiten Gehör finden, braucht es vernünftige Journalisten. Analyse, Bewertung und Einordnung werden wichtiger - die bloße journalistische Weitervermittlung reicht nicht mehr aus.
Was ist Ihr gegenwärtiger Forschungsschwerpunkt?
DR. GRIMMER: Aktuell setzen wir uns an der Uni Tübingen intensiv mit dem Selbstmarketing von Athleten in Sozialen Medien auseinander. Dabei geht es insbesondere um das Stichwort Nutzerpartizipation. Schließlich hat nicht nur der Journalismus die Möglichkeit, sich neu zu erfinden. Auch die sogenannten Public Relations werden sich weiterentwickeln. Welche Themen kommen bei Rezipienten besonders gut an? Wie sollten Inhalte aufbereitet sein, um Reaktionen zu erhalten? Hierbei nehmen wir auch internationale Unterschiede in den Blick.
Zur Person vom 11. März 2015
Dr. Christoph G. Grimmer ist in Crailsheim aufgewachsen, hat hier in Vereinen Sport getrieben und am Albert-Schweitzer-Gymnasium Abitur gemacht. Anschließend studierte er Diplom-Sportwissenschaft an der Uni Hamburg, wo er auch promovierte. Heute arbeitet der 29-Jährige als Lehrkraft für besondere Aufgaben im Arbeitsbereich Sportökonomik, Sportmanagement und Sportpublizistik an der Uni Tübingen.
SWP
Das könnte dich auch interessieren

Jetzt abstimmen: Wer wird Amateur-Torschütze des Monats Mai?
Falter Amateur-Tor des Monats 🏆⚽️: Jetzt abstimmen für euren Favoriten +++ VIDEO mit allen Traumtoren
Bezirksliga Donau & Donau/Iller: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spieler der Saison 2023/2024.
Die Sommertransfers der Verbandsliga Württemberg im Überblick
Welche Klubs der Verbandsliga Württemberg sich im Sommer verstärkt haben, gibt es auf einen Blick.
Nach Instagram-Followern: Wer wäre in der Verbandsliga Tabellenführer?
FuPa präsentiert: Das Social-Media Ranking der Verbandsliga!
